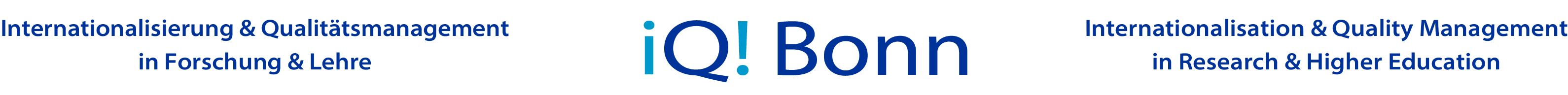孔夫子搬家 ——〈尽是书〉尽是输
Kǒngfūzǐ bānjiā —— jìn shì shū
Konfuzius zieht um —— <alles nur Bücher> nichts als Verluste
Konfuzius ist der Inbegriff des Gelehrten in China. Und der Haushalt eines Gelehrten besteht vor allem aus Büchern. Die Worte für „Bücher“ und „Verluste“ klingen im Chinesischen gleich.
脱裤子放屁 —— 多此一举
tuō kùzi fàngpì —— duō cǐ yī jǔ
Die Hosen ausziehen, um einen fahren zu lassen —— eine überflüssige Aktion; das kann man sich sparen/schenken
Dieser Redensart hat Professor Dr. Michael Steindl (Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt) einen kurzweiligen Aufsatz gewidmet, vgl. "Tuo ku-zi fang-pi und andere Redensarten", in: Der Sprachdienst, 47, 5, S. 166–172.
天津卫的包子 —— 狗不理
Tiānjīnwèi de bāozi —— Gǒubùlǐ
Bāozi [gefüllte Dampfbrötchen] aus Tiānjīn —— <von Gǒubùlǐ> (Dialekt) sehr unbeliebt; von dem nimmt kein Hund ein Stück Brot
包子 bāozi sind kleine, gefüllte Dampfbrötchen; in Peking gibt es an fast jeder Ecke einen Imbissstand, der sie feilbietet. Besonders bekannt und beliebt sind die eines 1858 in Tiānjīn gegründeten Ladens namens Gǒubùlǐ. Filialen von Gǒubùlǐ sind auch im heutigen Peking anzutreffen.
猫哭老鼠——假慈悲
māo kū lǎoshǔ——jiǎ cíbēi
Eine Katze trauert um eine Maus —— <vorgetäuschtes Mitleid> Krokodilstränen vergießen
孔夫子的徒弟 ——〈贤人〉闲人
Kǒngfūzǐ de túdi —— xiánrén
Konfuzius Schüler —— <tugendhafte Menschen> Müßiggänger
Nach der Lehre des Konfuzius strebt der ideale Mensch, der Edle, danach, die vier grundlegenden Tugenden zu verwirklichen: Mitmenschlichkeit, Gerechtigkeit/Pflichtgefühl, kindliche Pietät und Sittlichkeit/Riten. Somit sind die Schüler des Konfuzius „tugendhafte“ Menschen. Aus dem Gleichklang der chinesischen Bezeichnung für „Tugend“ und „Müßiggang“ ergibt sich das Wortspiel.
景德镇的尿壶 ——〈瓷好〉词好
Jǐngdézhèn de niàohú —— cí hǎo
Ein Nachttopf aus Jǐngdé —— <gutes Porzellan> wohlklingende Worte
Der Ort Jǐngdé ist auch über die Grenzen Chinas hinaus für sein hervorragendes Porzellan bekannt. Das xiēhòuyǔ bezieht sich auf die sehr gute Qualität verbaler Äußerungen oder schriftlich niedergelegter Gedanken. Gern auch wird damit ironisch zum Ausdruck gebracht, dass etw. in schöne Worte gefasst, aber ohne inhaltliche Tiefe ist. Das Wortspiel basiert auf der Homophonie von „Porzellan“ (瓷 cí) und „Wort“ (词 cí).
鸡毛炒韭菜——乱七八糟
jīmáo chǎo jiǔcài——luàn qī bā zāo
Hühnerfedern mit Schnittlauch anbraten —— (ugs.) ein heilloses Durcheinander; 1. chaotisch; 2. dubios, undurchsichtig
Hühnerfedern mit Schnittlauch vermischt symbolisieren das totale Chaos: Sie gehören nicht zusammen und sind – einmal vermischt – nie wieder zu trennen. 乱七八糟 luànqī-bāzāo kann einerseits eine dubiose bzw. ungesetzliche Sache bezeichnen, andererseits aber auch unhaltbare Zustände.
和尚打伞 ——〈无发无天〉无法无天
héshang dǎsǎn ––– <wú fà wú tiān> wú fǎ wú tiān
Ein buddhistischer Mönch mit Schirm —— <[hat] kein Haar und [sieht] keinen Himmel> (chéngyǔ) irdischen und himmlischen Gesetzen trotzen; gesetzlos
Das Bild im A-Teil hat hier keine metaphorische Funktion. Es dient lediglich als Aufhänger für ein witziges Wortspiel, das auf der Homiophonie (Quasi-Homophonie) von Haar (chin. fà) und Gesetz (chin. ebenfalls fǎ) beruht. Ein buddhistischer Mönche hat ein kahlgeschorenes Haupt, der Schirm nimmt ihm die Sicht auf den Himmel.
Das Tetragramm 无法无天 bedeutet, dass etw./jmd. irdischen und himmlischen Gesetzen trotzt.
狗咬耗子——多管闲事
gǒu yǎo hàozi——duō guǎn xiánshì
Ein Hund fängt Ratten —— kümmert sich um Dinge, die ihn nichts angehen; die Nase in anderer Leute Angelegenheiten stecken
Eine chinesische Redensart sagt „Katzen fangen Mäuse, und Hunde bewachen das Haus“. Ein Hund, der Ratten jagt, kümmert sich also um Dinge, die ihn nichts angehen.
公母俩打架 ——〈好急了〉好极了
gōngmǔliǎ dǎjià —— <hǎo jí le> hǎojí le
Ein Ehepaar zofft sich —— <da fliegen die Fetzen> (iron.) super; prima
Bei Streitigkeiten zwischen Eheleuten wird man Rücksicht und Takt nur zu oft vermissen; dazu stehen sich die Ehepartner zu nah. Durch homophonen Wechsel ergibt sich die Bedeutung "Super!", die im Kontext des A-Teils jedoch eine ironische Note erhält.
陈世美当驸马——喜新厌旧
Chén Shìměi dāng fùmǎ——xǐ xīn yàn jiù
Chén Shìměi wird Schwiegersohn des Kaisers –– <„er liebt eine Neue und hasst die Alte“> häufiger Partnerwechsel; jmd., der die Freundinnen wechselt wie andere die Hemden
Der Kaiser war von den Talenten des Chén Shìměi, einem armen Gelehrten vom Lande, so begeistert, dass er ihm die Hand seiner Tochter anbot. Dabei ahnte er nicht, dass Chén bereits verheiratet war. Der wiederum wollte von seiner schlichten Frau nichts mehr wissen, als man ihm eine Prinzessin zur neuen Frau gab.
包公审案——铁面无私
Bāogōng shěn'àn——tiěmiàn–wúsī
Richter Bao hält Gericht —— (chéngyǔ) er ist unparteiisch und unbestechlich; objektiv/gerecht und unbestechlich
Bāo Zhěng 包拯 (999–1062) war ein hoher Beamter der Nördlichen Sòng-Dynastie (960–1127), dessen Rechtschaffenheit und Gerechtigkeitssinn in China sprichwörtlich geworden sind. Nach seinem Vorbild wurde die Figur des gerechten Richters Bao geschaffen, die in späteren Epochen sowohl in Singspielen als auch in Kriminalgeschichten und Theaterstücken Verwendung fand.
爱窝窝打金钱眼——蔫准
àiwōwo dǎ jīnqiányǎn——niānzhǔn
Mit einem Klebreisklößchen nach der Glücksmünze werfen —— <geräuschlos treffen> (Dialekt) still/zurückhaltend, aber zielstrebig; ein stilles Wasser
Im 白云观 Báiyúnguàn, dem taoistischen Tempel der Weißen Wolke, im Südwesten Pekings befindet sich im Eingangsbereich eine große Kupfermünze mit einem Loch in der Mitte, in dem an einer Schnur eine kleine Glocke befestigt ist. Im alten China öffnete dieser Tempel jedes Jahr zum Frühlingsfest, also zu Beginn des neuen Jahres, der Allgemeinheit seine Pforten. Die Besucher warfen dann mit Geldstücken nach der kleinen Glocke: Ein Treffer, der durch ein helles Klingen nicht zu überhören war, wurde als Omen für ein glückliches neues Jahr gedeutet; diesen Brauch, der in den letzten Jahren wieder aufgelebt ist, nennt man 打金钱眼 dǎ jīnqiányǎn. Würde man mit einem klebrigen Reisklößchen statt mit einem Geldstück nach der Glocke werfen, bliebe ein Treffer geräuschlos.
爱窝窝 àiwōwo (auch 艾窝窝) sind Reisklößchen mit einer süßen Füllung aus Rosinen, Nüssen oder Melonenkernen. Man bereitet sie speziell zum Frühlingsfest aus Klebreis zu.
王麻子的剪刀 —— 冒充的多
Wáng Mázi de jiǎndāo —— màochōng de duō
Scheren vom "Pockennarbigen Wáng" —— <oft kopiert> es gibt viele Imitate
Der „Pockennarbige Wáng“, so lautet der Name eines Scherengeschäfts in Peking, das früher in China ebenso bekannt für seine qualitativ hochwertigen Waren war wie Solingen in Deutschland. In der Pekinger Dì'ān Mén Wài Dàjiē 地安门外大街, unweit des Glockenturms, verweist heute ein Schild auf den berühmten Sohn der Stadt. Dort hatte Wáng Mázi 1651 sein Geschäft gegründet.